Schellings Erlanger Vorlesungen | 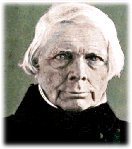 |
Schelling geht hier von einem Grundgesetz aus. Demnach ist die Aussage, , "[d]aß die ewige Freiheit sei", das "Höchste und Letzte, und hätten wir dieses gefunden, so wären wir hier schon am Ende der Wissenschaft" (Init: 77). "Die ganze Wissenschaft muß eine fortgehende Selbstdarstellung jener ewigen Freiheit sein." (ebd.: 23)
Dabei ist das Ziel, auf das Schelling philosophisch hinarbeitet, ist nicht nur das, was möglich ist, sondern was wirklich ist. Das kann als materialistischer Inhalt der Philosophie von Schelling interpretiert werden, die sich auch explizit gegen Hegels Konzept richtet, denn er äußert sich gegen diesen:
Das Mögliche
Die ewige Freiheit entspricht dem Sein Gottes vor der Erschaffung der Welt. Diese Freiheit ist ganz absichtsloser Wille (ebd.). Wäre sie auf etwas gerichtet, und wirkend, würde sie zum Wollen - hier aber ruht der Wille noch ganz in sich, er enthält das "Vermögen aus, sich in alle Gestalten zu begeben und in keiner zu verweilen" (ebd.: 25). Die "fortgehende Selbstdarstellung" verläuft über die Entfaltung von Potenzen. Was Schelling unter Potenzen versteht, ändert sich häufig, hier ist die höchste Potenz jene des "Seinkönnens", die der ewigen Freiheit zukommt.
Dieses hungrige Sein muss sein, und damit sind wir bei der Potenz des "Seinmüssens" (ebd.: 79). Was bedeuten diese beiden Potenzen "Seinkönnen" und "Seinmüssen" nun zusammen genommen? Schelling sieht im "Seinsollen" diese Einheit. Das Seinsollende kann sein und es muss sein.
Die eben entwickelten Potenzen sind Potenzen des Seins (ebd.: 81) und Gott ist für Schelling die Einheit des Seinkönnens, des Seinmüssens und des Seinsollens. Es ist allen wirklichen Formen des Seins entbunden (ebd.: 92). Der Zustand der ewigen Freiheit befindet sich zeitlich gesehen in einem Bereich, in dem von Dauer noch gar nicht die Rede sein kann (ebd.: 195). Nach Schelling "müssen wir dem Zustand der ewigen Freiheit einen Zustand der Unbewußtheit voraussetzen, möge dieser auch nur einen Augenblick sein. Denn die Dauer dieses Zustandes ist uns gleichgültig; denn es kann ja von gar keiner Dauer die Rede sein." (ebd.). Dieser Zustand ist übernatürlich, "[d]enn gerade im Sich-nicht-wollen liegt alle Übernatürlichkeit. Im Sich-selbst-Begehren [aber] liegt eigentlich der Anfang aller Natur. Dieses ist nämlich über alle Natur, auszuharren im nichtswollenden Willen." (ebd.: 133)
Übergang vom Möglichen zum Wirklichen
Aber da es Wirkliches gibt, entsteht die Frage nach dem Übergang vom Möglichen zum Wirklichen, vom Potenziellen zum Aktuellen. Dabei ist das Wirkliche das Seiende und das Mögliche ist nichtseiend, verborgen im Wirklichen (ebd.: 91). Die verschiedenen Potenzen sind der grundlos gesetzte Grund (ebd.: 94) für das Wirkliche und sie kommen auf verschiedene Weise zur Wirklichkeit, zum Sein.
Das Reich der Tat
Es kann zwar nichts mehr aus Ursachen oder aus dem Begriff abgeleitet werden, aber es kann weiter diskutiert werden: "Was sollte sein? Was wäre besser in Beziehung auf die Endursache des Ganzen: wenn das Sein innerlich blieb oder hervorträte?" (ebd.) Der Orientierungsmaßstab ist das Gesetz des Lebens, "das alles Entscheidende und in Krisis Setzende" (ebd.: 116):
"Denn das höchste Gesetz alles Lebens ist: es soll Freiheit sein; und dieses ist das höchste Gesetz des Universums: es soll nichts andres sein als ewige Freiheit. Jedes soll, was es ist, mit Freiheit sein. Was etwas ist, soll es nicht blindlings, sondern mit seinem Willen sein; und selbst das Nichts soll dieses nicht blindlings sein, sondern weil es das Sein sich versagt. Wo irgend etwa, wenn auch bewußtlos, zwischen Entweder-oder sich befindet, so waltet doch ein Gesetz." (ebd.: 106)
Vor diesem Richterstuhl lässt sich auch das Übergehen des Seinkönnenden ins Sein rechtfertigen: Das Gesetz "es will, daß alles seinen Willen habe und zeige, damit es heraustrete als das, was es ist" (ebd.: 118), denn mit diesem Heraustreten ist "eine viel größere Entfaltung der Einheit und des ganzen Lebens gesetzt" (ebd.). In der Äußerung kann das Seinkönnen auch mehr seiner Möglichkeiten offenbaren, als in einer Entscheidung für das Nichtsein. Trotzdem ist das Heraustreten des Könnenden in das Sein eine Erniedrigung und das entstandene Sein strebt immer wieder nach dem ursprünglichen Zustand zurück (ebd.: 119 f.). Diese Konstruktion erweist sich deshalb als sinnvoll, weil es ja bewusstlose natürliche Kreaturen gibt. Welchen Sinn macht deren Existenz aus der Sicht des Gesetzes des Lebens? Nur den genannten, dass ihre Existenz eine Durchgangsphase der Bewegung der Verwirklichung der ewigen Freiheit ist. Das Verhältnis von ewiger Freiheit im Reingeistigen und den Verwirklichungsformen in der Natur erinnert an die Unterscheidung von natura naturans und natura naturata des frühen Schelling. Hier nun bezieht sich Schelling auf eine andere Sprechweise: "Deshalb wird Gott bald als ein Plural |