|
Kritische Psychologie |
|
|
Kritische Psychologie erarbeitet als "marxistisch fundierte Subjektwissenschaft" (Holzkamp 1984)
Bewußtes Handeln erfordert die Analyse gegebener Bedingungen und Möglichkeiten sowie die Entwicklung von eigenen Zielen. Da jede/r Einzelne und auch die gesamte menschliche Zivilisation jeweils eingebettet ist in ein Umfeld, sind die Wechselbeziehungen genauer zu bestimmen. Oft werden die Beziehungen auf jeweils eine Ebene oder eine Richtung reduziert: |
|
|
Tatsächlich jedoch ist immer eine Vielfalt von Vermittlungen zu beachten. Philosophisch wurde dies bspw. von J.-P.Sartre eingefordert: Sehr problematisch ist die Tatsache, "daß die Menschen ihre Lebensverhältnisse produzieren und gleichzeitig unter diesen Lebensverhältnissen existieren". Diese Wechselseitigkeit verkompliziert alle Methoden, menschliches (eigenes oder fremdes) Verhalten zu verstehen und zu beeinflussen. |
|
Diese gegenseitige Verflechtung kann als "zirkuläre Kausalität" (H.Haken) bezeichnet werden. Prozesse, bei denen der Gesamtprozeß die eigenen Bestandteile selbst erzeugt, werden autopoietisch genannt. Alle natürlichen komplexen Strukturen strukturieren/organisieren sich auf solche Weise selbst. Das jeweils Umfassende kennzeichnet "Allgemeines", seine Momente sind demgegenüber "Einzelne" und "Besondere". |
|
Die Kritische Psychologie untersucht insbesondere die Zusammenhänge von "menschlicher Natur" im Subjekt und gesellschaftlicher Entwicklung. |
|
3. Inhalt 3.0.
3.1. Was sind Menschen?
Die Bewertung des Verhaltens anderer Menschen und die Orientierung des eigenen Verhaltens hängt stark von der Einschätzung darüber ab, wovon das Verhalten von Menschen abhängig ist. |
|
Oft wird direkt oder indirekt eine ewige, überhistorische "Natur des Menschen" angenommen. Dieser "Natur" werden dann verschiedene Eigenschaften zugesprochen. Zwischen einem Menschen als "infantilem Affen mit gestörter innerer Sektretion" und dem Menschen als "Inbegriff Gottes" ist alles drin. |
|
Tatsächlich jedoch kommen dem Menschen wie allen anderen Dingen und Prozessen nur jeweils konkret historisch bestimmte Wesenszüge, und keine überhistorisch festen und starren zu. |
|
Die Wesensbestimmung (die zum Inhalt des Begriffs führt) läßt sich gut ermitteln, wenn danach gesucht wird, was das neu Entstehende gegenüber dem Vorherigen unterscheidet. |
|
Die Werkzeugherstellung und -nutzung durch Menschen unterscheidet sich von jener der Tiere dadurch, daß die Werkzeuge nicht nur für den unmittelbaren Gebrauch erzeugt und benutzt werden, sondern zur späteren Nutzung oder Nutzung durch andere aufgehoben werden (Lenz, Meretz, S. 61). |
|
Wenn bisher der Zweck der Mittelherstellung vorausging, so bleibt jetzt das Mittel für spätere und andere Zweckerfüllungen vorhanden und bringt eine neue Ebene in die Evolution ("Produktionsmittel", die sich auch verselbständigen). |
||
|
Dadurch entstand eine geplante verallgemeinerte Vorsorge im Lebensgewinnungsprozeß auf gesellschaftlicher Grundlage (Holzkamp 1984). Dadurch sind die Bedeutungen für Menschen keine eindeutigen Handlungsdeterminanten, sondern nur
Handlungsprämissen (1998, S. 299). Diese Prämissen lassen ihm genügend Spielraum zu
Entscheidungen innerhalb von Möglichkeiten (→ Möglichkeitsbeziehung). Das objektive Sein legt zwar eine vom Stand der Produktivkräfte abhängige Bedingtheit fest - läßt aber immer Freiraum zur Wahl und Schöpfung neuer Möglichkeiten. Die Verbindung zwischen Schaffung und Nutzung der Lebensmittel/-bedingungen ist nicht mehr unmittelbar, wie bei den anderen Lebewesen. Bei Menschen entwickelte sich eine "Distanz" zu den eigenen Bedürfnissen (Holzkamp 1985, S. 244). Dies ermöglicht ein bewußtes Verhalten ihnen gegenüber. Für die Menschen geht Sartre noch weiter und rückt das Mögliche stärker in den Mittelpunkt. T. König kennzeichnet Sartres Denken: Jeder Mensch wird begrenzt und eingeengt. Aber sein Wesen ist durch das Überschreiten einer Situation gekennzeichnet, durch das, was ihm aus dem zu machen gelingt, was man aus ihm gemacht hat (Sartre ME, 101). "Der Mensch ist also durch seinen Entwurf definiert. Dieses materielle Wesen überschreitet unablässig die ihm gesetzte conditio; es enthüllt und bestimmt seine Situation, indem es sie transzendiert, um sich durch die Arbeit, die Tat oder die Geste zu objektivieren.." (Sartre ME, 162). Sartre übersieht die Einschränkungen, die dem Menschen auferlegt sind, nicht. Einem Arbeitslosen "wird es ...nicht gelingen, aus dem Elend herauszukommen, aber mitten in diesem Elend, an dem er klebt, kann er wählen, in seinem Namen und im Namen aller anderen gegen alle Formen des Elends zu kämpfen; er kann wählen, der Mensch zu sein, der es ablehnt, daß das Elend das Los der Menschen sei" (Sartre 1944, S. 60). "... es gibt keine Auswege zu wählen. Ein Ausweg, der wird erfunden." (Sartre 1947, S. 90) 3.2. Möglichkeitsbeziehung Da nach Holzkamp der Einzelne auch seine Existenz erhalten kann, wenn er sich nicht an der Erhaltung des Systems beteiligt (durchschnittlicher Charakter gesellschaftlicher Handlungsnotwendigkeiten) haben die gesamtgesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten für den Einzelnen bei aller Beschränkung nicht unbedingt "zwingenden" Charakter (Holzkamp 1985, S. 235ff.). "Individuell sind die gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten für mich nur Handlungsmöglichkeiten" (Holzkamp 1983, S. 142). Die spezifisch menschliche Freiheit ist durch die Alternative gegeben, nicht oder anders zu handeln. "Menschen können wollen" (Lenz, Meretz, S. 60).
3.3. Handlungsfähigkeit Grundlegendes Motiv und Handlungsziel für Menschen ist nach Holzkamp die Erringung, Verteidigung und Ausweitung der Handlungsfähigkeit. Sie läßt sich charakterisieren als "Verfügung des Individuums über seine eigenen Lebensbedingungen / Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozeß" (Holzkamp 1985, S. 241).
Die notwendige bewußt-vorsorgende Verfügung über gesellschaftlich-individuelle Lebensbedingungen ("personale Handlungsfähigkeit") erfordert und entwickelt eine Überschreitung der Individualität (Holzkamp 1984) und der zeitlichen Unmittelbarkeit. Menschen sind nicht "zufrieden", wenn sie lediglich ihre aktuellen Bedürfnisse befriedigen können, sondern sie benötigen die "Perspektive eines vorsorgend abgesicherten individuellen Daseins" (Holzkamp 1984). Daraus ergibt sich auch: So beschränkt die Möglichkeiten zur Entwicklung der Handlungsfähigkeit konkret auch sein mögen - sie gibt eine generelle Richtungsbestimmung vor, "mit welcher erfaßt werden kann, wie sich die allgemeine Richtungsbestimmung der Tendenz zur erweiterten Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen durch Teilhabe an gesellschaftlicher Vorsorge unter den je konkreten gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen und -behinderungen... durchsetzt" (Holzkamp 1984). Die konkreten individuellen Entwicklungen bewegen sich im Spannungsfeld von verallgemeinerter Handlungsfähigkeit und den Entwicklungsrestriktionen. Dies impliziert eine Kritik der jeweiligen Restriktionen. Gerade die Wahrnehmung und Analyse der Restriktionen der Handlungsfähigkeit unter kapitalistischen Bedingungen kann uns zur Überzeugung bringen, "daß uns jetzt und hier immer noch "am besten geht", wenn wir um die Überwindung jeder gesellschaftlichen Verhältnisse kämpfen, unter denen wir mit uns selbst uneins sein müssen, da im Kampf selbst die Beziehungsformen und Befindlichkeiten zur Verfügung über unsere Lebensbedingungen partiell schon vorweggenommen werden"(Holzkamp 1984). |
|
2. Zur Methode
Wegen den vielen Vermittlungsebenen ist es wichtig, überhaupt erst einmal den "Gegenstand" zu bestimmen, über den man etwas erfahren will. Dieser ist nicht einfach "gegeben", sondern wird durch die spezifische Fragestellung erst mit erzeugt/konstruiert (Dies ist der Hintergrund des "Konstruktivismus" und wurde erstmals deutlich als Problem artikuliert von I. Kant). Die klare Bestimmung des Gegenstandes ist auch notwendig für Argumentationen. Wenn Personen bei empirischen Sachverhalten z.B. aneinander "vorbeireden", sollte der begriffliche Hintergrund abgeklärt werden. Unterschiede auf dieser Ebene erklären sich i.a. durch unterschiedliche Auffassungen über das Wesen der Erkenntnis, die vielleicht noch im theoretischen Gespräch abklärbar sind. Die Stellung und Interessen in den realen gesellschaftlichen Prozessen jedoch ist nur noch über lebenspraktisch übergreifende Prozesse in Einklang zu bringen (nach Holzkamp S. 29ff.): |
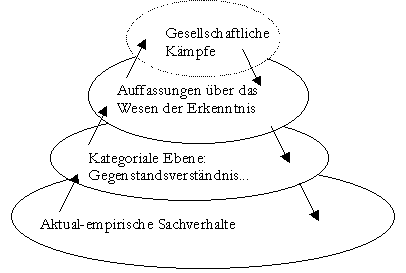 |
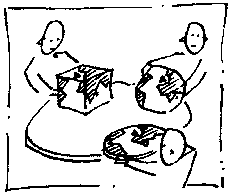 (Abb: Casswell bei Benking) |
|
|
Worauf kann man sich nun bei der Gegenstandsbestimmung beziehen? Der Bezug zur Umwelt ist ja im allgemeinen nicht abstrakt und allgemein, sondern berührt konkrete Beziehungen. Die Vermittlungszusammenhänge zwischen Organismus und Umwelt sind durch Bedeutungen gegeben (Lenz, Meretz 59). |
|
Bedeutungen entstanden im Verlauf der biotischen Evolution aus stoffwechselneutralen Signalen, die für den Organismus auf bestimmte Umwelttatbestände verweisen. |
|
Über Bedeutungen kann der Gegenstand schließlich auch begrifflich erfaßt werden. Begriffe verweisen auf die wesentlichen Zweck- und Eigenschaftsdimensionen eines Gegenstands (Lenz, Meretz, S. 66). Sie erfassen einerseits unseren Bezug zum Gegenstand, andererseits beruhen sie auf den ihm wesenseigenen Merkmalen. |
|
Der Bezug zum Gegenstand durch uns wird von Hegel geleugnet. Der Begriff geht über das Wesen (Gesetz) dadurch noch hinaus, daß "jeder seiner Momente kann nur unmittelbar aus und mit den anderen gefaßt" wird (Hegel, Enz I., S. 314). |
|
Hilfreich zur Einordnung der Gegenstandsbestimmung ist folgende Unterscheidung: 1. Ebene: spezifisch-menschliche Prozesse, die die menschliche Natur bestimmen: 2. Ebene: spezifisch-menschliche sekundäre Prozesse, die nur Menschen zukommen, aber nicht seine Natur bestimmen: existenzsichernde Primärbedeutungen und Sekundärbedürfnisse 3. Ebene: unspezifisch-menschliche Prozesse: Orientierungsfunktion mit spez. menschlicher Ausprägungsform (nicht mit denen von Tieren vergleichbar) 4. Ebene: unspezifisch-physiologische Prozesse - erst hier Vergleichbarkeit und Analogisierung sinnvoll (Lenz, Meretz S. 157) Jede dieser Ebenen benötigt eigene erkenntnistheoretische Grundlagen und daraus entwickelte praktische Verfahren. |
Benking, H., Embodying Situations & Issues, Sharing Contexts, and Encouraging Dialogue, online in: http://www.ceptualinstitute.com/genre/benking/ifsr/IFSRnov98pp.htm, mit Abb. von T.Casswell Bloch, E., Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis, Frankfurt/Main 1985 Hegel, G., W., F., (Enz. I) Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Erster Teil, Werke Band 8, Frankfurt am Main 1986 Holzkamp, K., Zum Verhältnis zwischen gesamtgesellschaftlichem Prozeß und individuellem Lebensprozeß, in: Streitbarer Materialismus, Diskussions-Sonderband 6 der Zeitschrift "Konsequent", Westberlin 1984, S. 29-40 Holzkamp, K., Grundlegung der Psychologie, Frankfurt/Main, New York 1985 Holzkamp, K., Der Mensch als Subjekt wissenschaftlicher Methodik, in: Braun, K. H,, Hollitscher, W., Holzkamp, K. & Wetzel, K. (Hrsg.), Karl Marx und die Wissenschaft vom Individuum, Marburg 1983 König, T., (Hrsg.), Sartre, J.,P., Lesebuch: den Menschen erfinden Lenz, A., Meretz, S., Neuronale Netze und Subjektivität, Braunschweig/Wiesbaden 1995 Sartre, J.-P., (ME) Fragen der Methode, Reinbek 1999 Sartre, J.-P., (1944) "Klarstellung oder Der Existentialismus ist ein Humanismus", Lesebuch Den Menschen erfinden, Hrsg. T. König, Reinbek 1996 Sartre, J.-P., (1947) " Was ist Literatur? Oder Von der Notwendigkeit des schriftstellerischen Engagements ", Lesebuch Den Menschen erfinden, Hrsg. T. König, Reinbek 1996 Törpel., B., Meretz, St., Projekt "Begriffliche Fundierung der Informatik" – Bericht über den Stand unserer Überlegungen, August 1991 |
|
Viel mehr Infos dazu unter:
Zum Bereich Psycho-Phylogenese siehe auch:
Die
Mehr zur Kritischen Psychologie im Philosophenstübchen
|