|
Umfassende Bereiche:
The present crisis in the relationship of mankind, technology and nature endangers the existence of the whole biosphere. We won´t overcome this crisis through romanticism. Innovations in technical and social respect can lay the foundations to a new relationship between Mankind and Nature. The article combines knowledge about ecology, evolution theory, new technological tendencies and our possibilities to overcome the crisis. Ernst Bloch gave us interesting words to characterize different forms of technology: "List-Technik" and "Allianz-Technik". Also we see that not only technological innovations can help us. It is necessarily to change our life-concepts and -forms.
1. Welt-Krise
Die heutige Krise im Verhältnis von Mensch,Technik und Natur
gefährdet die Existenz der Biosphäre. Die Lösung
dieser Krise wird nicht mit einem rückwärtsgewandten
Romantizismus gelingen. Innovationen auf technischer wie auf sozialer
Ebene können ein neues Verhältnis zwischen Mensch und
Natur begründen.
Die umfassende Naturzerstörung dieses Jahrhunderts durch die menschlichen Eingriffe ist zwar hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit und der Großräumigkeit ohne Beispiel - jedoch waren die vergangenen Jahrhunderte auch nicht gerade von einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur geprägt. In Europa waren beispielsweise im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung noch 90% der Fläche bewaldet. Im 11. Jahrhundert waren es nur noch 20%.
Diese rapiden Veränderungen schädigten die Ökosysteme
zwar, aber diese konnten sich stets noch regenerieren.
In diesem Jahrhundert hat sich diese Situation geändert.
Die Eingriffe in die Natur erfolgen in solch umfassendem Maße
und derart schnell, daß die natürlichen Ökosysteme
das nicht mehr durch eine Anpassung "auffangen" können.
Es geht auch längst nicht mehr nur um die verschiedenen Lebensformen,
sondern die Atmosphäre der Erde droht "umzukippen".
Allein die durch alle Prozesse erzeugte "Ab"-Wärme
bringt die atmosphärischen Regelkreise aus ihren bisherigen
dynamischen Gleichgewichten.
Es könnte möglich sein, daß es bereits "5
Minuten nach 12 Uhr" ist. Vielleicht werden die von Klimaexperten
bereits als sicher vorhergesagten extremen Veränderungen
des Klimas nur von wenigen, anspruchslosen Lebensformen überlebt.
Aber solange es noch nicht so weit ist, enthält die Wirklichkeit
noch andere Möglichkeiten.
2. Krisen in der Entwicklung - Chancen
für Neues Ein Rückblick in die Geschichte der Biosphäre mag zum Erkennen dieser Möglicheiten hilfreich sein. Auch ohne die Menschen hat die Biosphäre bereits mehrere Krisen durchgemacht und durch Innovationen "gemeistert". Die ersten Lebensformen entstanden als einzellige Bakterien in einer Kohlendioxid-Atmosphäre. Diese Einzeller ernährten sich vom Kohlendioxid und setzten dabei Sauerstoff frei. Sauerstoff aber ist ein Zellgift. Mit der Anreicherung der Atmosphäre durch Sauerstoff und das Sinken des Kohlendioxidanteils in der Luft entstanden zwei "globale Probleme" für diese ersten Lebensformen. Das Kohlendioxid fehlte als notwendiges Treibhausgas, das lebensnotwendige Wasser der Erde drohte zu gefrieren - und der Sauerstoff wirkte giftig. Beide Probleme wurden gemeistert. Einerseits konnten die Zellen sich durch geeignete "Einbauten" vor dem giftigen Sauerstoff beschützen, andererseits existierten gleichzeitig Lebewesen, die aus toten Organismen wieder Kohlendioxid und das ebenfalls als Treibhausgas wirkende Methan erzeugten. Die Lebens-Krise wurde gemeistert durch Innovationen und durch die gemeinsame Weiterentwicklung ("Ko-Evolution") von Lebensformen und atmosphärischer Zusammensetzung. Weltanschaulich bezieht sich vor allem James Lovelock mit seinem Gaia-Konzept auf diese Zusammenhänge.
schreibt er. "Gaia" als die lebendige Erde entsteht
bei ihm dadurch, daß sich aus der örtlich begrenzten
Aktivität von Organismen ein globales Regulierungssystem
entwickelt.
Auf diese Wechselwirkungen können wir jedoch nicht einfach
abwartend setzen, wenn es um die jetzige Welt-Krise geht. Wir
lernen aus dem obigen Beispiel jedoch etwas über die notwendigen
Voraussetzungen: die innere Plastizität
und die wechselwirkende Vielfalt der
Beteiligten. Beide Bedingungen sind im Konkreten zu erhalten oder
neu herzustellen. Aus dieser Sicht heraus ist mir der Begriff der "Nachhaltigkeit" aus der Ökologiedebatte zu defensiv. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist aus der Forstwirtschaft übernommen, wo er bedeutet, daß nicht mehr Holz geschlagen werden darf, als neu wächst.
Es geht aber nicht nur um ein quantitatives
"weniger", sondern um eine qualitative Veränderung
unseres Verhältnisses zur Natur. Aus den bekannten Entwicklungen des Lebendigen auf der Erde können wir noch mehr lernen außer den Bedingungen für Innovationen, die bisher erwähnt wurden.
Ein wichtiges Evolutionsprinzip ist der Funktionswechsel (steht
hier allgemein auch für Funktionssynthese, -differenzierung,
-erweiterung).
Neues entsteht nicht nur aus zufälligen Mutationen, wie oft
behauptet wird. Neues wächst auf der Grundlage vorhandener
Strukturen, im Speziellen oft daraus, daß vorhandene Strukturen
eigentlich mehrere Funktionen erfüllen können. Knochen
stabilisieren einerseits die Strukturen des Organismus - nebenbei
können sie aber auch den Schall übertragen. Aus dieser
Nebenfunktion kann unter Umständen die Hauptfunktion werden.
Teile des Kiefergelenks bei Reptilien wurden beim Säugetier
zurückgebildet, andere Teile gingen nicht etwa verloren,
sondern bilden nun Teile des Gehörs. Allgemeiner gesprochen stoßen wir hier auf eine interessante Wechselwirkung zwischen Mitteln und Zielen. Vorhandene (nicht aber unbedingt alle!) Mittel/Strukturen können neuen Zielen/Funktionen dienen - und verändern sich dabei dann auch selbst wieder. Entwicklung baut also auf Vorhandenem auf und erzeugt dabei Neues. Das Neue ist dabei nicht immer nur eine kleine, kontinuierliche "Ver-schlimm-Besserung" des vorliegenden Zustands. Wenn nicht ein totes Gleichgewicht vorliegt, sondern evolutive Prozesse weitab vom Gleichgewicht geschehen - so gelten die Erkenntnisse des Selbsorganisationskonzeptes.
"Eine weit vom Gleichgewicht entfernte funktionierende Ordnung
kann deshalb einer Organisation ähneln, weil sie aus der
Verstärkung einer mikroskopischen Schwankung hervorging,
die genau im "richtigen" Augenblick einen Reaktionsweg
aus der Reihe von weiteren, ebenso möglichen Wegen begünstigte."
(Prigogine, Stengers).
3. Funktions- und Strukturwechsel
in Technik und Gesellschaft
Das Bild des Lebendigen in der Natur ist umstritten. Bereits Darwin
relativiert das Bild des "Kampfes ums Dasein": "...
aber man könnte auch sagen, eine Pflanze kämpfe am Rande
der Wüste mit der Dürre ums Dasein; obwohl man das ebensogut
so ausdrücken könnte: sie hängt von der Feuchtigkeit
ab."
Genauso läßt sich das Verhältnis von mensch-erzeugter
Technik und Natur von zwei Seiten beleuchten. Die Technik als
Überlebens-Waffe des Menschen - oder als hochentwickelte
Form der Selbst-Beeinflussung der Natur durch naturerzeugte Menschen.
Diese beiden Seiten sind jedoch nur in der abstrakten Betrachtung
einander gleich zu setzen. In der Realität gibt es Entwicklungsstufen
dieses Verhältnisses.
Tatsächlich muß die heutige Gestaltung und Anwendung
der Technik einer Kritik unterworfen werden. Sie überträgt,
um mit den Worten Ernst Blochs zu sprechen, den Ausbeuter- und
Tierbändigerstandpunkt auf die Natur. Sie nutzt natürliche
Gesetzmäßigkeiten aus, aber nur im Sinne von "Überlisten"
der Natur. "Unsere bisherige Technik steht in der Natur wie
eine Besatzungsarmee in Feindesland..." (Bloch, S.814). Ernst Bloch bezieht diese Kritik jedoch nicht auf eine "Technik an sich". Technik ist nur ein Mittel im Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Ganz im Sinne des oben erwähnten Funktionswechels orientiert er auf eine Technik, die die Natur nicht überlistet, sondern mit ihr "kommuniziert".
Solch eine Vorstellung ist nur möglich, wenn die Natur selbst
als schöpferisch und produktiv angesehen wird. Die von ihm
angestrebte Allianz-Technik ist eine "Entbindung und Vermittlung
der im Schoß der Natur schlummernden Schöpfungen"
(Bloch, S. 813). Sie überlistet die Naturkräfte nicht,
sondern "verwendet die Wurzel der Dinge mitwirkend"
(Bloch, S. 805).
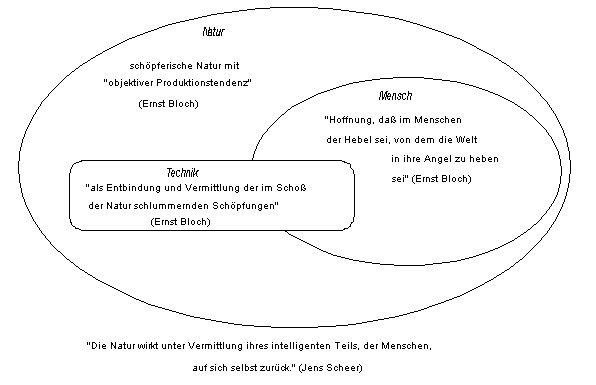
Bei der Neukonzipierung einer ökologisch verträglichen
Produktions- und Lebensweise ist also auf Technik nicht zu verzichten,
sondern sie auf neue Weise in den Stoffwechsel zwischen Mensch
und Natur einzubinden. Der Funktionswechsel der vorhandenen technischen
Mittel wird auch eine Auswahl, Aussonderung und Umgestaltung der
Technik erfordern.
Ein wichtiger Hinweis ist auch, daß die Natur sich selbst-organisiert
bewegt und auch die Gesellschaft ein selbst-organisiertes System
ist. Nur die Technik "dazwischen" beruht vorwiegend
noch auf auf den Mechanismen der klassischen Mechanik, des statischen
Gleichgewichts und einer Kybernetik, die nur die Herstellung (thermodynamischer)
Gleichgewichte kennt. Hier sind selbst-organisierte Techniken
zu entwickeln. Frederic Vester nähert sich den Aufgaben konkreter. Er nennt verschiedene Merkmale "biokybernetischer" Produktionstechniken:
Diese Technologien sind interessanterweise nur dann effektiv und produktiv, wenn die Organisationsräume klein und die Methoden und Produkte vielfältig sind. Die Technik selbst fordert hier Veränderungen der Produktionsorganisation und der Lebensweise.
Der Wandel ist damit nicht auf Technik reduzierbar, sondern erfordert
ebenfalls "soziale Erfindungen" (Robert Jungk).
Aus diesen Perspektiven heraus ist Ernst Bloch - dem "Philosophen
der begriffenen Hoffnung" - zuzustimmen: "Natur ist kein Vorbei, sondern der noch gar nicht geräumte Bauplatz, das noch gar nicht adäquat vorhandene Bauzeug für das noch gar nicht adäquat vorhandene menschliche Haus." (Bloch, 807)
Zu dem adäquat vorhandenem menschlichen Haus gehört,
daß nicht nur die Mittel zu ökologisieren sind, sondern
auch die Ziele menschlicher Produktionstätigkeit. Lebensgerechte
Bedürfnisse und bedürfnisgerechte Produktion bedeuten
primär nicht Stagnation oder Verzicht, sondern die Erfindung
anderer als geld-anhäufender Freuden im Leben.
Aber dies ist bereits ein anderes Thema, greift über die
Biosphäre hinaus und erzeugt eine Noosphäre (Biosphäre
und Gesellschaft entwickeln sich gemeinsam in Ko-Evolution). In
ihr erst geschieht der "wirkliche Einbau der Menschen (sobald
sie sozial vermittelt worden sind) in der Natur (sobald die Technik
mit der Natur vermittelt worden ist)" (Bloch, S. 817).
Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung,Frankfurt/Main, 1985
und FORUM WARE 25 (1997) Nr. 1-4, S. 167-170 (Wien) siehe auch:
|